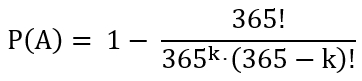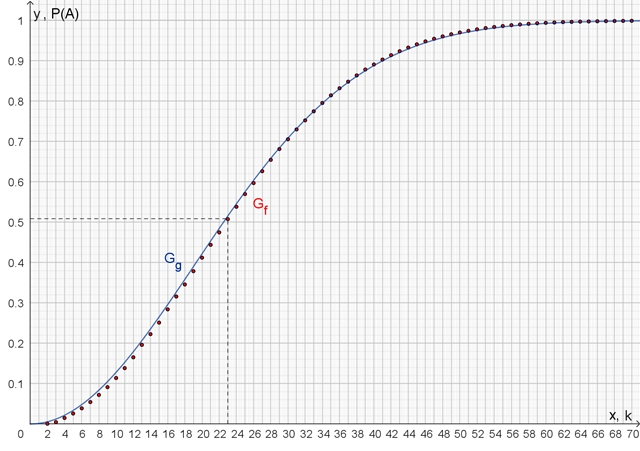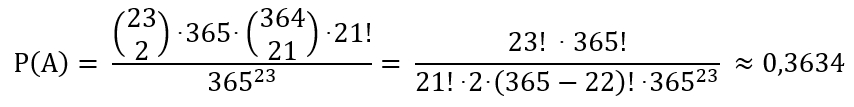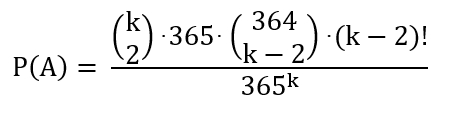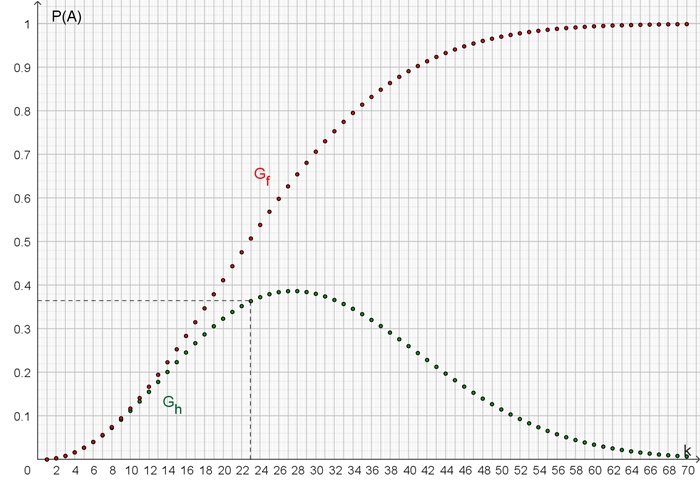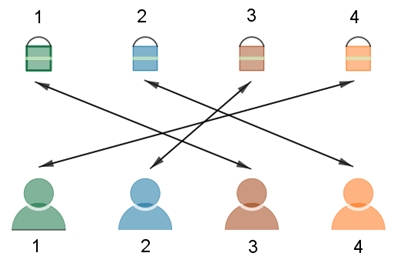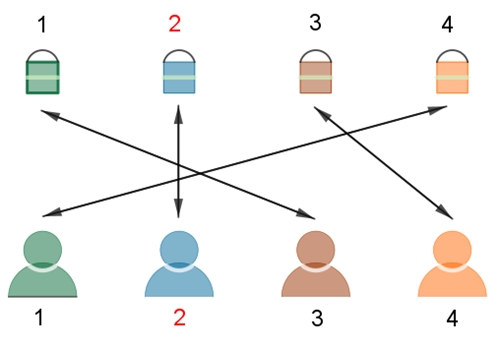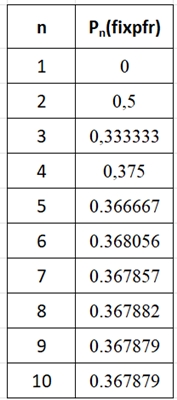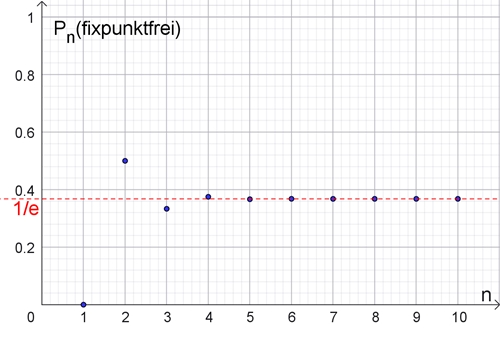|
Das Geburtstagsparadoxon 1. Fall:
In einem Zimmer befinden sich z.B.
23 Personen. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 Personen am
gleichen Tag Geburtstag haben (Ereignis A)?
Um diese Wahrscheinlichkeit P(A) zu berechnen geht man
zunächst von der Gegenwahrscheinlichkeit
Die (Laplace-)Wahrscheinlichkeit P(A) eines Ereignisses A erhält
man, indem man die Anzahl |A| der für A günstigen Ergebnisse durch
die Gesamtzahl m der möglichen Ergebnisse dividiert.
Entsprechendes gilt für das Gegenereignis
Damit gilt für die Wahrscheinlichkeit P(A):
Mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 50,7 %
haben mindestens 2 von 23 Personen am gleichen Tag Geburtstag.
Das Ergebnis ist für viele Menschen verblüffend und
wird deshalb als Paradoxon bezeichnet.
Allgemein gilt für die Wahrscheinlichkeit, dass
mindestens 2 von k Personen
am gleichen Tag Geburtstag haben:
Grafische Darstellung Gf
für die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 von k Personen
am
gleichen Tag Geburtstag haben
Näherung durch die Funktion mit der Gleichung
2. Fall:
In einem Zimmer befinden sich z.B. 23 Personen. Wie groß ist dann die
Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 Personen am gleichen Tag Geburtstag haben
(Ereignis A)?
Mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr
36,3 % haben genau 2 von 23 Personen am gleichen Tag Geburtstag.
Allgemein gilt für die Wahrscheinlichkeit, dass
genau 2 von k Personen
am gleichen Tag Geburtstag haben:
Ab der Anzahl k = 28 von Personen wird wird es
unwahrscheinlicher, dass genau 2 Personen (und nicht mehr Personen) am gleichen Tag Geburtstag
haben.
Grafische Darstellung Gh für die
Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 von k Personen
am gleichen Tag Geburtstag haben
Das Wichteln-Paradoxon
Wichteln
ist ein vorweihnachtlicher Brauch, bei dem sich Jugendliche in
Jugendgruppen, in Schulklassen oder Arbeitskollegen gegenseitig beschenken.
Dabei sollen die Geschenke gesammelt und dann zufällig verteilt werden.
Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit,
dass keine Person ihr eigenes Geschenk erhält?
Beispiele einer zufälligen
Verteilung, im rechten Fall erhält die 2. Person ihr eigenes Geschenk
Bei der Lösung der Aufgabe geht es darum,
dass n Personen (1, 2, 3, …,n) n Geschenke (1, 2, 3, …,n) zufällig umkehrbar
eindeutig zugeordnet werden.
Eine Permutation z.B. der Zahlen
1, 2, 3, . . . , n gibt eine Anordnungsmöglichkeit der n verschiedenen
Zahlen an.
Die Anzahl aller möglichen Permutationen
(Anordnungen) werden durch die Fakultät i.Z. ! dargestellt:
n! = 1⸱2⸱3⸱. . .⸱n
Veranschaulichung z.B. der Permutation 1
⟶ 3, 2
⟶ 1, 3 ⟶ 2
In Zweizeilenform:
In Tupelschreibweise: (3, 1, 2), in obiger
linker Figur (3, 4, 2, 1), in rechter Figur (3, 2, 4, 1)
Der Fixpunkt einer Permutation ist
dadurch gekennzeichnet, dass bei der Tupelschreibweise an der i-ten Stelle
die Zahl i steht:
Beispiele in Tupelschreibweise, Fixpunkte
sind rot dargestellt:
n=1: 1! = 1
(1), 0%
fixpunktfrei
n=2: 2! = 2
(1,
2), (2, 1), 50% fixpunktfrei
n=3: 3! = 6
(1,
2, 3),
(1, 3, 2), (2, 1,
3), (2, 3, 1), (3, 1, 2), (3,
2, 1): 33%
fixpunktfrei
n=4: 4! = 24
(1 ,2,
3, 4),
(1, 2,
4, 3), (1, 3, 2,
4), (1,
3, 4, 2), (1, 4, 2, 3), (1,
4, 3, 2),
9 von 24 sind fixpunktfrei, das sind 37,5% Allgemein gilt für die Anzahl der fixpunktfreien Permutationen in Abhängigkeit von n:
z.B: n=4: ! 4 = 24⸱(1
– 1 + 1/2 – 1/6 + 1/24) = 9 Für die Wahrscheinlichkeit der fixpunktfreien (fixpfr) Permutationen gilt dann in Abhängigkeit von n:
Tabelle für n
∊
{1, 2, 3, . . ., 10}
Es fällt auf, dass bereits bei n = 7 die Wahrscheinlichkeit für
eine fixpunktfreie Permutation dem Grenzwert sehr nahe kommt.
NR: Taylor-Reihe der
Exponentialfunktion
Für x = –1 folgt obiger Grenzwert.
Grafische Darstellung von Pn(fixpfr)
in Abhängigkeit von n
Übertragen auf das Ausgangsproblem gilt dann:
Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa
36,8% erhält bei mehr als 5 Personen keine Person ihr eigenes Geschenk.
Umgekehrt gilt mit einer
Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1 – 0,368 = 63,2% (Gegenwahrscheinlichkeit),
dass mindestens eine Person bei mehr als 5 Personen ihr eigenes Geschenk
erhält.
Das Ergebnis ist verblüffend und zählt zu den
Paradoxien der Wahrscheinlichkeit. |